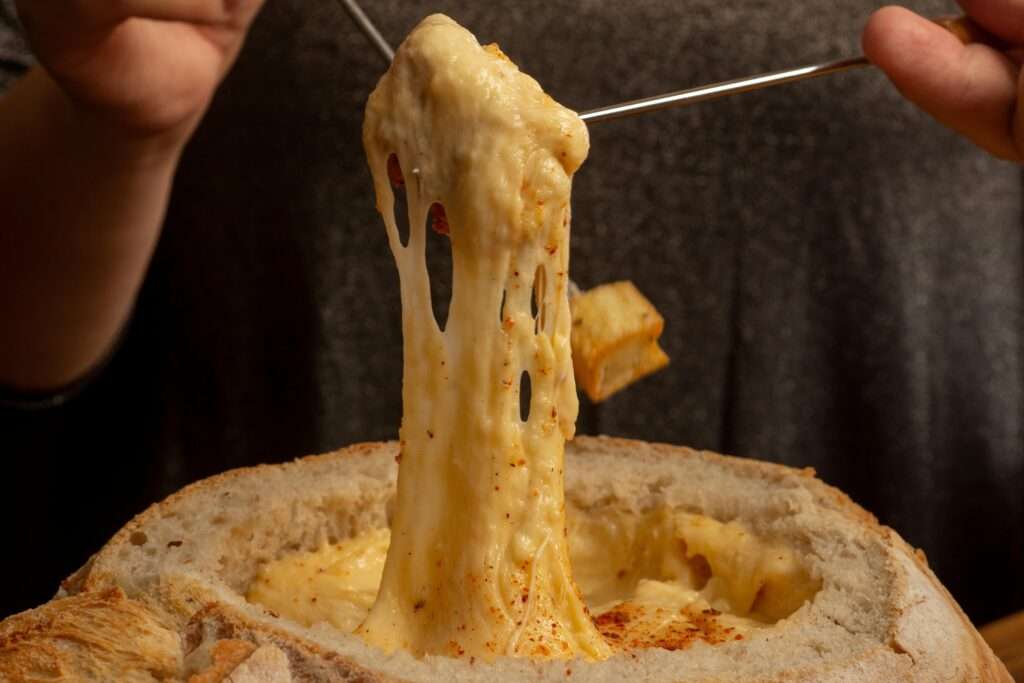

Münster. Die Stadt Münster hat einen umfassenden Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention entwickelt. Dieser völkerrechtlich bindende Vertrag verpflichtet auch Kommunen, geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt konsequent zu bekämpfen. Der vom Rat 2022 beschlossene Auftrag führte unter Beteiligung zahlreicher Organisationen, Betroffener und Fachstellen zu einem Maßnahmenkatalog mit 81 konkreten Punkten. Ziel des Aktionsplan Istanbul-Konvention Münster ist es, die bestehenden Schutzlücken vor Ort zu identifizieren – und im Idealfall zu schließen. Doch zwischen Anspruch und Umsetzung tun sich Hürden auf.
Der Plan umfasst vier zentrale Handlungsfelder: Prävention, Schutz und Unterstützung durch allgemeine sowie spezialisierte Hilfen und die Rolle von Justiz und Strafverfolgung. Flankiert werden diese Bereiche von Querschnittsthemen wie Barrierefreiheit, Monitoring und der gezielten Unterstützung vulnerabler Gruppen. Um Fortschritte zu sichern, ist eine eigene Koordinierungsstelle vorgesehen. Wie dringend der Handlungsbedarf ist, zeigt nicht zuletzt ein Beispiel, das viele Betroffene betrifft – und das System grundlegend in Frage stellt.
Einer der gravierendsten Missstände betrifft den Zugang zu Frauenhäusern. Viele Betroffene – etwa Studentinnen, trans* Frauen ohne gesicherten Aufenthalt oder EU-Bürgerinnen – müssen den Aufenthalt selbst bezahlen, obwohl sie sich in akuten Gewaltsituationen befinden. Die Istanbul-Konvention fordert hingegen einen niedrigschwelligen, kostenfreien Zugang zu Schutzräumen. In der Realität sind diese Plätze häufig von Leistungsansprüchen abhängig.
In Münster gibt es aktuell lediglich 19,2 sogenannte Familienplätze – das bedeutet: knapp zwanzig Frauen mit Kindern können gleichzeitig Schutz finden. Nach Einschätzung von Fachstellen bräuchte es jedoch mindestens 32 Plätze. Die Finanzierung erfolgt derzeit über eine Mischung aus Landesmitteln, kommunalen Geldern, Spenden und – problematisch – Eigenleistungen der Betroffenen. Der Aktionsplan schlägt in den Maßnahmen 65 bis 69 ein neues Finanzierungssystem vor. Künftig soll eine Pauschale die bisherigen Tagessätze ersetzen. Parallel dazu sind Übergangslösungen wie Schutzwohnungen vorgesehen, außerdem die Öffnung für bislang ausgeschlossene Gruppen, darunter Frauen mit älteren Söhnen, trans* Personen und wohnungslose Frauen.
Laut einer Erhebung des Amts für Gleichstellung bleiben viele Frauen trotz akuter Gefährdung außerhalb des Hilfesystems. 100 % der befragten Träger gaben an, dass längst nicht alle Betroffenen den Weg zu Unterstützung finden. Die Gründe sind vielfältig: fehlende Informationen, Sprachbarrieren, mangelnde Barrierefreiheit – etwa für seh- oder hörbehinderte Personen – sowie Scham oder Angst vor Stigmatisierung.
Besonders problematisch: Nur die Hälfte der Einrichtungen kann innerhalb von 24 Stunden ein Erstgespräch anbieten. In vielen Fällen vergehen 48 bis 72 Stunden bis zum ersten Kontakt. Etwa 29 % der Betroffenen werden aufgrund fehlender Kapazitäten sogar abgewiesen. Die Maßnahmen 2 bis 7 und 45 bis 52 setzen an diesen Stellen an. Sie sehen u. a. den Ausbau mehrsprachiger Informationen, die Einbindung der barrierefreien „Tess“-App für Gehörlose im Polizeidienst und Schulungen für Behörden vor. Eine neu gestaltete Website mit barrierefreiem Zugang soll außerdem zentrale Informationen bündeln und den Zugang erleichtern.
Ein innovativer Baustein im Aktionsplan ist die neu geregelte Zusammenarbeit zwischen Polizei und Beratungsstellen. In Fällen häuslicher Gewalt übergeben die Beamtinnen und Beamten – mit Zustimmung der Beteiligten – direkt die Kontaktdaten von Opfern und Tätern an Fachstellen. Dieser Schritt ermöglicht ein proaktives Handeln, das insbesondere dann hilfreich ist, wenn Betroffene selbst keinen Antrag stellen.
Mit eingebunden sind das Frauenhaus & Beratung e. V., die Fachberatung des SkF sowie die Krisen- und Gewaltberatung für Männer beim CV Münster. Maßnahme Nr. 10 sieht zudem den Aufbau interdisziplinärer Fallkonferenzen zur Gefährdungsanalyse vor. Ziel ist es, sowohl Opfer als auch Täter frühzeitig in begleitende Prozesse zu bringen. Damit wird auch dem Gedanken der Prävention Rechnung getragen – einer der zentralen Pfeiler der Istanbul-Konvention.
Trotz klarer Zielsetzungen und fundierter Analysen bleibt die Umsetzung vieler Maßnahmen ungewiss. Der Aktionsplan Istanbul-Konvention Münster macht deutlich, dass zentrale Fortschritte – etwa bei Barrierefreiheit oder Notunterkünften – von zusätzlichen politischen Beschlüssen, Fördermitteln und personellen Ressourcen abhängen.
Aktuell fehlen laut Angaben des Amts für Gleichstellung mindestens 11,5 Vollzeitstellen in Beratungsstrukturen. Solange diese nicht geschaffen werden, droht ein Großteil des Plans auf dem Papier zu verharren.