
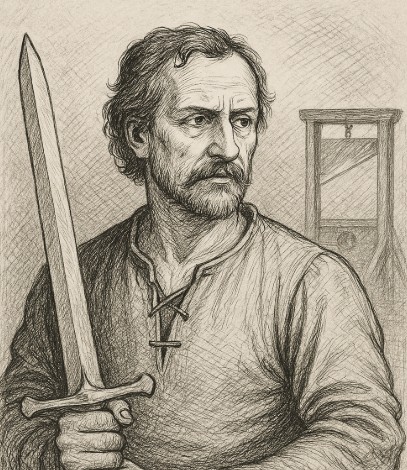
Münster blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück, in der auch Henker eine bedeutende Rolle spielten. Henker in Münster waren jahrhundertelang fester Bestandteil der Rechtsprechung und vollstreckten die härtesten Urteile jener Zeit. Ihre Tätigkeit war gefürchtet und von grausamen Ritualen begleitet, doch sie gehörten zum Alltag der Strafjustiz. Dieser Artikel beleuchtet die Geschichte Münsters im Hinblick auf die Henker – von den frühen Hinrichtungsplätzen bis hin zu Johann Hermann Leissner, der als letzter Henker der Stadt Münster in die Annalen einging. Abschließend werfen wir einen Blick darauf, wie sich das Verständnis von Recht und Gerechtigkeit seitdem gewandelt hat und warum es heute keine Henker mehr gibt.
In vergangenen Jahrhunderten verfügte Münster sowohl über eine bischöfliche als auch eine städtische Blutgerichtsbarkeit. Das bedeutete, dass schwere Verbrechen mit dem Tode bestraft werden konnten. Verurteilt wurde nicht nur bei Mord oder Raubmord, sondern zeitweise auch bei Delikten wie schwerem Diebstahl, Hexerei oder Münzfälschung. Öffentliche Hinrichtungen dienten der Abschreckung und fanden oft vor den Toren der Stadt statt. So gab es vor den mittelalterlichen Stadtmauern bestimmte Richtplätze: Etwa die Galgenheide südwestlich vor Münster, die bereits im 14. Jahrhundert erwähnt wird und als Hinrichtungsstätte diente. Dort standen die Galgen des Stadtgerichts, und Verurteilte wurden durch Hängen, Rädern, Verbrennen oder Enthaupten hingerichtet – grausame Spektakel, denen oft Schaulustige beiwohnten.
Ein berühmtes Kapitel der Stadtgeschichte stellt die Täuferherrschaft in den 1530er Jahren dar. Nach der blutigen Niederschlagung dieser religiösen Rebellion wurden im Januar 1536 die Anführer der Täuferbewegung – unter ihnen Jan van Leiden, Bernhard Knipperdolling und Bernhard Krechting – in Münster öffentlich zu Tode gefoltert und hingerichtet. Anschließend hat man ihre Leichname in eisernen Käfigen am Turm der Lambertikirche aufgehängt, um die Bevölkerung abzuschrecken. Diese drei Käfige sind bis heute an der Lamberti-Kirche zu sehen und erinnern an die brutale Vergangenheit der Rechtsprechung in Münster. Solche Exempel zeigen, welch schreckliches, aber wirksames Instrument der Henker im Machterhalt und in der Strafjustiz früherer Zeiten war.
Die Person des Henkers – auch Scharfrichter oder früher Nachrichter genannt – nahm eine zwiespältige Stellung in der Gesellschaft ein. Einerseits war der Henker in Münster notwendig, um Urteile des Gerichts zu vollstrecken; andererseits haftete ihm das Stigma des „unehrlichen“ Berufs an. Henker und ihre Familien lebten oft am Rande der Stadt oder in speziellen Häusern, da viele Bürger den direkten Kontakt mit ihnen mieden. In Münster gab es beispielsweise die sogenannte Scharfrichterei an der Klosterstraße, die dem Scharfrichter als Wohnung und Wirkungsstätte diente. Direkt daneben befand sich die Abdeckerei, denn Henker übernahmen häufig auch die Aufgabe des Abdeckers (Schinders), der verendetes Vieh entsorgte. Diese wenig angesehenen Arbeiten waren mit dem Henkersamt verbunden und verschafften dem Henker zusätzliche Einnahmen.
Trotz ihrer Ausgrenzung besaßen Henker spezielles Wissen und bestimmte Privilegien. Sie verstanden sich auf den Gebrauch von Folterinstrumenten und auf verschiedene Hinrichtungsmethoden, entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften. In früheren Zeiten gehörte auch die Folter (peinliche Befragung) zum Strafprozess – der Scharfrichter setzte Daumenschrauben, Streckbank oder glühende Zangen ein, um Geständnisse zu erzwingen. Bereits im 18. Jahrhundert setzte jedoch allmählich ein humanerer Umgang mit Beschuldigten ein: Folter wurde in vielen Regionen abgeschafft (in Preußen z.B. 1740), und die Zahl öffentlicher Qualen nahm ab. Dennoch blieb der Henker bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein eine gefürchtete Figur, die zwischen Faszination und Abscheu stand. Viele sahen in ihm einen notwendigen Vollstrecker der Gerechtigkeit, zugleich aber einen unheimlichen Außenseiter.
Du liest unsere Nachrichten kostenlos und unabhängig. Hilf mit einem Beitrag deiner Wahl.

Im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert gelangten die Tage des städtischen Henkers in Münster an ihr Ende. Johann Hermann Leissner gilt als letzter Henker Münsters. Leissner wurde 1762 in Telgte bei Münster als Sohn einer Scharfrichterfamilie geboren. Schon in jungen Jahren trat er in die Fußstapfen seines Vaters und übernahm 1793 dessen Amt in Telgte. In den folgenden Jahren weitete er sein Tätigkeitsgebiet aus: Er wurde Scharfrichter im Umland, etwa in Dülmen (ab 1796) und Wolbeck (ab 1799). Schließlich berief man ihn 1801 zum offiziellen Henker der Stadt Münster. Damit stand Leissner im Dienst des Magistrats der Stadt und erhielt ein festes Gehalt sowie Wohnung und Arbeitsraum in der städtischen Scharfrichterei. Wie seine Vorgänger war er zugleich für die Abdeckerei zuständig, hatte also das Monopol auf die Beseitigung toter Tiere im Umland – ein typisches Privileg des Henkers, das bis zur Einführung der Gewerbefreiheit 1810 Bestand hatte.
Johann Hermann Leissners Amtszeit fiel in eine Zeit großer Umbrüche. Kurz nach seiner Anstellung endete Münsters alte Rechtsautonomie: 1803/1804 übernahmen erst die Preußen, dann zeitweise die Franzosen die Herrschaft, was die städtische Gerichtsbarkeit veränderte. Leissner führte in seiner Karriere nur noch wenige Hinrichtungen durch – laut eigenen Berichten um 1804 waren es in zwölf Jahren etwa fünf Exekutionen. Während der französischen Besatzung Westfalens ab 1806 wurde sogar die Guillotine in Münster eingeführt. 1812 richtete man auf dem Domplatz eine solche Fallbeil-Maschine ein, und Leissner, nun als staatlicher „Executeur“ im französischen Département Lippe angestellt, musste fortan mit der Guillotine köpfen. Die klassische Hinrichtung mit dem Schwert oder dem Strang verlor allmählich an Bedeutung, zumal die neuen Machthaber – erst Napoleon, dann wieder Preußen – das Strafrecht vereinheitlichten. Die letzte Hinrichtung unter städtischer Regie lag schon zurück: Bereits 1798 hatte der Rat der Stadt vermutlich zum letzten Mal die Todesstrafe verhängt. Danach ging die Blutgerichtsbarkeit der Stadt Münster faktisch zu Ende.
Leissner selbst erlebte diesen Wandel unmittelbar. Er diente über drei Jahrzehnte, bis er im März 1836 im Alter von über 70 Jahren in Münster verstarb. Mit seinem Tod wurde kein neuer Henker mehr für Münster berufen – Johann Hermann Leissner war der letzte offizielle Scharfrichter der Stadt. Ein symbolischer Akt markierte das Ende dieser Ära: Leissners Witwe verkaufte im Jahr 1840 der Stadt Münster die drei historischen Richtschwerter, die sich im Besitz ihrer Familie befanden. Diese Schwerter aus den Jahren 1550, 1600 und 1690 – einst gebraucht, um „mit dem Schwert vollzogenes Recht“ an Münsters Bürgern zu üben – wurden fortan im Rathaus aufbewahrt. Bis heute sind sie in der Bürgerhalle des historischen Rathauses ausgestellt. Die Inschrift auf einer Klinge lautet: „Wenn ich das Schwert aufhebe, so wünsche ich dem armen Sünder das ewige Leben.“ Diese Worte geben einen bewegenden Einblick in die Doppelfunktion des Henkers: Er vollstreckte das irdische Urteil, sollte dabei aber – zumindest der Ideologie nach – Mitleid mit der Seele des Verurteilten haben.
Mit Leissners Tod und den politischen Reformen des 19. Jahrhunderts verschwand die Figur des stadteigenen Henkers aus Münster. Im Jahr 1851 verbot der preußische Staat öffentliche Hinrichtungen und das Zurschaustellen von Verurteilten am Pranger – ein deutliches Zeichen des zivilisatorischen Fortschritts. Fortan fanden die wenigen Hinrichtungen in Preußen nur noch hinter Gefängnismauern und unter staatlicher Aufsicht statt, ohne Schaulustige. Die Gesellschaft begann, die Todesstrafe zunehmend infrage zu stellen. Im 20. Jahrhundert wurden Exekutionen in Deutschland immer seltener. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs zog man endgültig einen Schlussstrich: 1949 schaffte das Grundgesetz der Bundesrepublik die Todesstrafe vollständig ab. Damit war der Beruf des Henkers hierzulande endgültig Geschichte. (In der DDR wurde zwar noch bis in die 1980er Jahre vereinzelt die Todesstrafe vollstreckt, doch auch dort ist sie längst abgeschafft.)
Heutzutage erscheint es unvorstellbar, dass am Prinzipalmarkt oder vor dem Stadttor Münsters Menschen öffentlich hingerichtet werden. Das drastische Spektakel von einst ist einem modernen Rechtsverständnis gewichen, das auf Menschenwürde, Resozialisierung und faire Gerichtsverfahren baut. Henker in Münster sind heute nur noch Figuren aus Geschichtsbüchern, Stadtführungen oder Museumsdarstellungen. Die Überreste jener Zeit – ob die Käfige an der Lambertikirche oder die Richtschwerter im Rathaus – mahnen uns, wie sehr sich Recht und Gerechtigkeit gewandelt haben. Münster hat den Weg vom mittelalterlichen Blutgericht zum liberalen Rechtsstaat vollzogen. Die Geschichte der Henker in Münster, und insbesondere das Schicksal des letzten Henkers Johann Hermann Leissner, zeigt eindrucksvoll, wie sich unsere Gesellschaft von grausamen Strafritualen hin zu humanen Werten entwickelt hat. Es ist eine Entwicklung, die deutlich macht: Was früher als Recht galt, würde heute als Unrecht verurteilt – und das Amt des Henkers gehört endgültig der Vergangenheit an.
Klaus Gimpel, Franz Predeek: „Der letzte Scharfrichter Münsters – mal über den Tellerrand geschaut“, in: Monatsblätter für Westfälische Landeskunde, Nr. 293 (Heimatbeilage der Westfälischen Nachrichten 1988). Zitiert nach Heimatverein Sendenhorst(Lebensdaten und Amtstätigkeit von Johann Hermann Leissner).
Universität Münster – Historische Orte der Strafvollstreckung in Münster: Überblick zu Richtstätten und Henkern der Stadt (EViR-Projekt) (Galgenheide als Hinrichtungsplatz; Erwerb der Richtschwerter 1840 von Leissners Witwe).
Oxford University – Cabinet: Execution of Münster Anabaptist Leaders in 1536 (Folter, Hinrichtung und Ausstellung der Täuferführer; Käfige an St. Lamberti).
Stern (stern.de): „Letzte Todesstrafe in Westdeutschland – Hinrichtung eines Raubmörders“ (Abschaffung der Todesstrafe 1949 in der BRD und Ende der Hinrichtungen in Deutschland).