
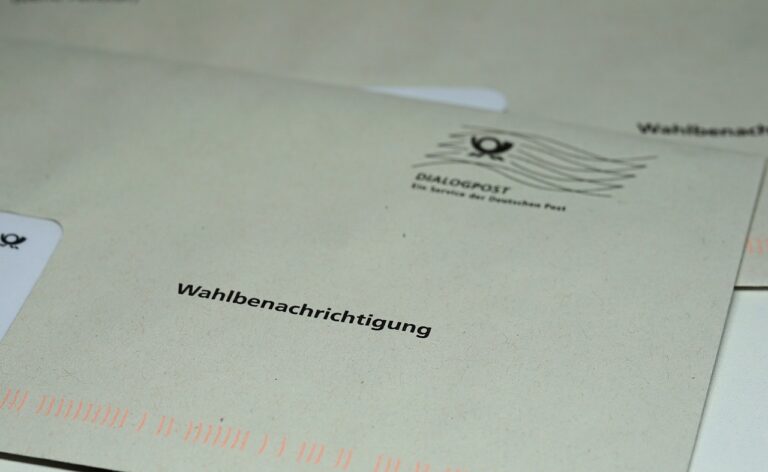
Das Kommunalwahlgesetz in NRW steht im Zentrum eines aufsehenerregenden Urteils: Der Verfassungsgerichtshof in Münster hat entschieden, dass zentrale Regelungen zur Sitzverteilung gegen die Landesverfassung verstoßen. Besonders hart träfe es kleinere Parteien, deren Chancen auf Mandate durch das neue Aufrundungsverfahren erheblich geschmälert würden. Das Gericht stellte eine klare Verletzung des Prinzips der Chancengleichheit fest – ein fundamentaler Bestandteil demokratischer Wahlen.
Die Entscheidung kommt zu einem brisanten Zeitpunkt. Bereits im September 2025 steht die nächste Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen an. Bis dahin muss das Gesetz dringend überarbeitet werden, um eine verfassungsgemäße Wahl durchführen zu können. Politisch brisant: Die umstrittene Neuregelung wurde 2024 mit den Stimmen von CDU, SPD und Grünen beschlossen – also aus der politischen Mitte heraus. Das Urteil stellt nun deren Reformprojekt massiv infrage.
Das Gericht kritisierte vor allem das neu eingeführte Verfahren zur Sitzverteilung. Bei Aufrundungen würden kleinere Parteien nach Überzeugung des Verfassungsgerichtshofes systematisch benachteiligt, indem Aufrundungsgewinne allein den großen Parteien zugewiesen werden. Zwar sollte die Reform ursprünglich Gerechtigkeit schaffen, doch laut Verfassungsgericht ist das Gegenteil eingetreten. Die neu geschaffene Regelung zur Stimmenaufwertung führe dazu, dass kleine Parteien systematisch bei der Verteilung leer ausgehen, während größere Parteien zusätzliche Mandate erhalten. Damit verstoße das Gesetz klar gegen das Gleichheitsgebot des Wahlrechts.
Die Richter wiesen darauf hin, dass das neue Verfahren nicht etwa eine bestehende Ungleichverteilung korrigiert, sondern diese Ungleichheit noch weiter verschärft. Das Gericht sprach in seinem Urteil von einem „gezielten Vorteil“ für größere Fraktionen, was einer bewussten Verzerrung des Wahlergebnisses gleichkomme.
Geklagt hatten mehrere kleinere Parteien und Gruppierungen: darunter Volt, Die Linke, die FDP, die Piratenpartei, Die Partei sowie das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht. Sie alle sahen sich durch das Gesetz in ihren demokratischen Grundrechten verletzt. Mit dem Urteil bekommen sie nun höchste Rückendeckung. Der Verfassungsgerichtshof stellt klar: Auch kleinere Parteien haben ein Recht auf faire Chancen bei der Mandatsverteilung.
Für die Demokratie in NRW ist das Urteil ein bedeutendes Signal. Es zeigt, dass Versuche, durch technische Änderungen im Wahlrecht politische Mehrheiten zu zementieren, rechtlich überprüfbar und gegebenenfalls unzulässig sind.
Bemerkenswert ist auch der knappe Ausgang des Verfahrens: Mit 4 zu 3 Stimmen sprachen sich die Richter gegen das Kommunalwahlgesetz in NRW aus. Präsidentin Barbara Dauner-Lieb konnte krankheitsbedingt nicht an der Urteilsverkündung teilnehmen. Ihr Stellvertreter, Vizepräsident Andreas Heusch, verlas das Urteil – obwohl er selbst zu den drei abweichenden Stimmen zählte. In einem Sondervotum äußerten Heusch und zwei Kollegen keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das Gesetz. Doch die Mehrheit der Richter urteilte anders – mit weitreichenden Folgen für das Wahlrecht in NRW.
Die Landesregierung steht nun unter Zeitdruck. Bis zur Kommunalwahl im September 2025 muss ein neues, verfassungskonformes Wahlgesetz verabschiedet werden. Andernfalls droht ein massiver Vertrauensverlust in die demokratische Ordnung. Das Urteil zwingt die Politik zur Rückbesinnung auf die Grundprinzipien des Wahlrechts: Gleichheit, Fairness und Transparenz.
Für viele kleinere Parteien bedeutet das Urteil Rückenwind. Es stärkt ihren Anspruch, gleichberechtigt am politischen Wettbewerb teilzunehmen. Der Druck auf CDU, SPD und Grüne wächst, eine Lösung zu präsentieren, die alle demokratischen Kräfte berücksichtigt.