
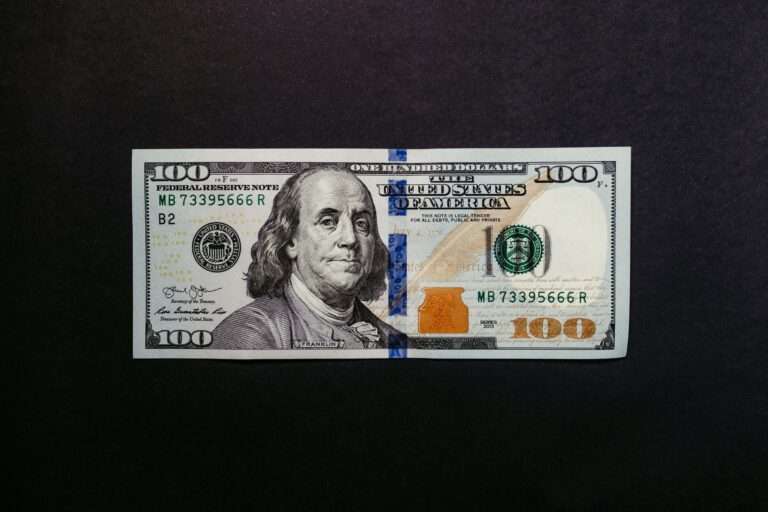
September 2006, eine Müllverbrennungsanlage bei Köln. In einem aufgerissenen Plastiksack entdecken Arbeiter fein geschredderte Dollarscheine – offenbar erschreckend perfekte Blüten. Die lokale Polizei schaltet wegen des Ausmaßes das Bundeskriminalamt ein. Tatsächlich stellt sich heraus, dass hier einer der größten Falschgeldfunde aller Zeiten gemacht wurde: 16,5 Millionen Dollar Falschgeld, der drittgrößte Dollar-Blütenfund weltweit. Winzige Hinweise – darunter faserige Schnipsel und rekonstruierte Seriennummern – führen die Ermittler zu einem unscheinbaren Atelier in Pulheim vor den Toren Kölns. Dort stoßen sie auf Hans-Jürgen Kuhl, 65 Jahre alt: Künstler, Siebdruck-Virtuose … und Deutschlands wohl begabtester Geldfälscher.
Hans-Jürgen Kuhl wächst im Rheinland auf. Nach der Schule absolviert er eine Lehre als Fotokaufmann und arbeitet ab 1970 als freischaffender Grafiker. Schon früh spezialisiert er sich auf Serigrafie (Siebdruck) und Collagen, inspiriert von Pop-Art-Größen wie Andy Warhol. In seinem eigenen Kölner Atelier produziert er bunte Drucke – von Clara Schumann bis Grimms Märchen –, die ihm lokale Anerkennung einbringen. Reich wird er davon aber nicht. Also experimentiert Kuhl mit allem, was Farbe, Raster und Papier hergeben. Zeitweise entwirft er sogar eigene Mode („Werbefummel“) und macht mit knalligen Hotpants kurzfristig gutes Geld. Doch langfristig geraten seine Finanzen ins Wanken.
Mitte der 1990er Jahre tritt ein kriminelles Trio – in Kuhls Erinnerung die „Vega-Leute“ – an ihn heran. Sie haben ein verlockendes Angebot: Er soll zehn Millionen US-Dollar in Blüten drucken, Auszahlung zum Bruchteil des Nennwerts in echter Währung. Kuhl zögert zunächst. Doch die Bande weiß um seine Fähigkeiten als Drucker und legt sogar 200.000 DM für neue Maschinen oben drauf. Schließlich willigt er ein. Schon 1999 fliegt dieser erste Fälschungsversuch jedoch auf: Kuhl wird zu 1,5 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Der Fehlschlag kostet ihn nicht nur seine teure Druckausrüstung, sondern fast seine gesamte Existenz – „unterm Strich eine Million“, wird er später sagen. Die milde Strafe aber zeigt ihm auch, dass selbst das Scheitern überschaubar sanktioniert wird. Seine Skrupel bröckeln.
Nachdem Kuhl erneut in eine finanzielle Schieflage geraten war, startete er einen zweiten, deutlich ambitionierteren Versuch. Er wählte die 100-Dollar-Note als Prüfstein seines Könnens, weil sie für ihre komplexen Sicherheitsmerkmale bekannt ist. Das Besondere lag dabei weniger im fertigen Ergebnis als in seiner Vorgehensweise: In einem mehrstufigen Prozess kombinierte er Offset- und Siebdruck. Zuerst erzeugte der Offsetdruck die mikroskopisch feinen Linien des Dollars, dann lief das Papier ein zweites Mal durch die Siebdruckanlage. Dort trug er einen farblosen, unter UV-Licht sofort härtenden Lack auf, der den typischen, tastbaren Stahlstich nachahmte.
Für alle weiteren Sicherheitsdetails – von einem dem US-Originalpapier ähnlichen, UV-unempfindlichen Spezialpapier aus Südosteuropa bis hin zu Wasserzeichen und irisierenden Kippeffekten – holte er sich spezielles Material und experimentierte unermüdlich. Nach unzähligen Ausschussbögen gelang ihm eine nahezu perfekte 100-Dollar-Note; nur den eingewebten Sicherheitsfaden konnte er nicht imitieren, was seine Abnehmer jedoch nicht störte. Am Ende lagen mehrere Millionen täuschend echter Scheine vor ihm – eine Qualität, die selbst erfahrene BKA-Experten verblüffte.
Gemeinsam halten wir unabhängige Nachrichten frei zugänglich. Was es dir wert ist, entscheidest du.

Doch was tun mit beinahe sechs Millionen Dollar Falschgeld? Kuhl hat längst einen Abnehmer organisiert – einen Unterweltkontakt aus Albanien, der das Falschgeld angeblich in seiner Heimat in Umlauf bringen will. Akribisch verpackt der Meisterfälscher die druckfrischen Blüten in Umzugskartons. Dann wartet er. Aber der Deal platzt: Der Albaner meldet sich plötzlich nicht mehr. Gerüchteweise will er „nur noch Euro, keine Dollars“ – das Projekt ist hinfällig. Nun lagern die perfekt gebündelten Blüten ohne Zweck im gemieteten Lagercontainer einer Industriebrache. Kuhl versucht zunächst, die überschüssigen Dollars zu vernichten: In einer Tonne im Hof verbrennen er und seine Komplizen ganze Bündel, doch der Rauch steigt gefährlich hoch. Kurzerhand schreddern sie einen Großteil der Scheine und entsorgen die konfettiartigen Reste tütenweise auf der Müllkippe.
Was übrig bleibt, verstaubt und vergilbt monatelang unbeachtet im Container. Kuhl kehrt frustriert zu legalen Auftragsarbeiten zurück – bis im Herbst 2006 die Polizei plötzlich vor der Tür steht. Was war passiert? Am 25. September 2006 hatte ein Müllmann in der Deponie zufällig einen blauen Plastiksack voller Dollarschnipsel aufgerissen. Darin fanden sich nicht nur verdächtig grün schimmernde Papierschnitzel, sondern auch Teile eines zerrissenen Briefumschlags. Die Ermittler setzen das Puzzle zusammen: Der Absender ist Hans-Jürgen Kuhl. Damit war die Spur gelegt.
Binnen eines Tages übernimmt das BKA die Operation und observiert Kuhl rund um die Uhr. Telefonleitungen werden abgehört, vor Kuhls Atelier beziehen Ermittler getarnt Stellung. Acht Monate lang geschieht – nichts. Keine Bewegung der Blüten, kein Käufer in Sicht. Schließlich beschließt die Polizei, das Spiel selbst in Gang zu bringen. Im Frühjahr 2007 taucht eine elegante Kunstsammlerin in Kuhls Atelier auf: Susann Falkenthal nennt sich die junge Frau, angeblich eine Unternehmerin mit besten Kontakten. Sie bewundert Kuhls Kunst und gibt ihm einen scheinbar harmlosen Auftrag für einen Grafikdruck – ein Vorwand, um Vertrauen zu schüren. Kuhl ahnt nicht, dass „Susann“ in Wahrheit eine verdeckte BKA-Ermittlerin ist.
Wenig später, an einem sonnigen Tag 2007, sitzt Kuhl mit der Dame bei Espresso und Pflaumenkuchen in einem Café vis-à-vis des Kölner Doms. Die Undercover-Agentin lässt durchblicken, dass sie in Litauen potentielle Abnehmer für seine „Privatdrucke“ kenne. Kuhl, gebauchpinselt, zeigt Interesse. Man einigt sich auf einen Testlauf: 250.000 $ in falschen Hundertern wechselt für 21.600 € den Besitzer – ein üblicher Schwarzmarktpreis von etwa 8,5 Cent pro Dollar. Die „Kundin“ ist zufrieden und meldet, ihr Partner sei an mehr interessiert. Kurz darauf bestellt sie 6,5 Millionen Dollar Blütenware für einen Großdeal. Kuhl wittert endlich die Chance, seine liegengebliebenen Bestände zu Geld zu machen, und willigt ein.
Der Austausch soll am 22. Mai 2007 über die Bühne gehen. Kuhl ist nervös. Zwar hat er jetzt einen Teil seiner Unkosten wieder hereinbekommen, doch der Umfang der Lieferung lässt ihn grübeln. Halb im Scherz hat er seinem besten Freund gegenüber die Chancen „fifty-fifty“ beziffert, dass man sich nach dem Termin wiedersieht. Zur Sicherheit packt er ein Köfferchen mit Zahnbürste und Wäsche für den Fall einer Festnahme. Dennoch fährt er zum verabredeten Treffpunkt – seinem Atelier – um die Ware zu übergeben. Kaum trägt Kuhl die ersten Kisten mit den Dollar-Bündeln nach draußen, geht alles ganz schnell: Ein Lieferwagen blockiert die Einfahrt, und rund 15 maskierte Beamte – ein Zugriffskommando des SEK – springen heraus. Kuhl wird überwältigt, Handschellen klicken. „Das war’s dann wohl“, denkt er sich, während die Polizisten die Pakete sicherstellen. Insgesamt beschlagnahmen die Fahnder an diesem Tag 16,5 Millionen falsche US-Dollar – bis dato der drittgrößte Dollar-Fund weltweit. Selbst CIA und Secret Service zeigen sich alarmiert ob der Menge und Qualität der Blüten.
Der Prozess vor dem Landgericht Köln gerät zur Formsache. Am 8. November 2007, nur wenige Monate nach seiner Festnahme, legt Hans-Jürgen Kuhl ein umfassendes Geständnis ab. Auf eine Zeugenvernehmung kann verzichtet werden, das Verfahren ist nach einem Verhandlungstag abgeschlossen. Das Urteil: sechs Jahre Freiheitsstrafe. Angesichts des Geständnisses und der besonderen Umstände bleibt der Richter am unteren Rand des Strafmaßes. Er würdigt Kuhl sogar als „außerordentlichen Grafiker“, der nur aufgrund „massiver finanzieller Schieflage“ zum Geldfälscher wurde. Kuhl kommt zudem in den offenen Vollzug – er darf tagsüber weiter in seinem Atelier arbeiten – und wird bereits nach dreieinhalb Jahren Haft entlassen.
Heute, fast zwei Jahrzehnte nach seinem Coup, ist Hans-Jürgen Kuhl geläutert – jedenfalls weitgehend. Der mittlerweile über 80-Jährige widmet sich wieder ganz der legalen Kunst. In Köln nennt man ihn augenzwinkernd den „kölschen Warhol“, denn er hat sich mit Siebdrucken im Pop-Art-Stil einen Namen gemacht. Marilyn Monroe, Mao Tse-tung, der VW-Käfer oder bunte Gummibärchen – unzählige Motive hat Kuhl in knalligen Farben aufs Papier gebracht. Auch für seine Heimatstadt setzt er sein Talent ein: Vor einigen Jahren startete er ein Projekt zugunsten des Kölner Doms. Kuhl druckte leuchtende Pop-Art-Editionen der Kathedrale, signierte Serigrafien in limitierter Auflage, und ein Teil des Erlöses floss in den Dombau-Verein. Die Druckmaschinen, mit denen er heute arbeitet, sind kleiner als damals, die Auflagen nummeriert und offiziell – doch die brillanten Farben und die Kreativität sind dieselben geblieben.
Spricht man Kuhl auf die „perfekte Note“ von einst an, huscht allerdings noch immer ein schelmischer Stolz über sein Gesicht. Er weiß genau, wie man eine Banknote nahezu fälschungssicher herstellt – und doch reizt es ihn bis heute. „Es fasziniert mich, wenn ich mit Tüftelei und Geduld zum Ziel komme“, gesteht er in einem Interview. Noch einmal wird er dieses Wissen aber wohl nicht illegal anwenden: Beim nächsten Mal würde er lebenslänglich kassieren, hat man ihm klargemacht. So bleibt Hans-Jürgen Kuhl am Ende kein skrupelloser Clan-Drucker, sondern ein Künstler, der seine meisterhafte Technik nur einmal auf die falsche Ware anwandte.
Hans-Jürgen Kuhl hat mit Kreativität, Akribie und krimineller Energie einen der besten Dollar-Fakes aller Zeiten geschaffen. Seine Geschichte liest sich wie ein Drehbuch: vom bankrotten Künstler zum „Fälscher der Herzen“ (wie ihn manche Ermittler augenzwinkernd nannten), der sogar die US-Behörden in Atem hielt. Am Ende siegte das Gesetz. Doch die Frage bleibt: War Kuhl ein Verbrecher aus Not, der die Regeln brach, um seine Kunst zu finanzieren? Oder ein Getriebener der eigenen Eitelkeit, der den perfekten Coup als ultimatives Kunstwerk sah? Wahrscheinlich von beidem etwas. Sicher ist: Hans-Jürgen Kuhl hat Fälschergeschichte geschrieben – im wahrsten Sinne des Wortes.
Texte werden mit Unterstützung von KI-Tools erstellt und vor Veröffentlichung redaktionell geprüft. Mehr dazu